 Originaltitel: The shock of the fall
Originaltitel: The shock of the fall
Verlag: Droemer
erschienen: 2015
Seiten: 320
Ausgabe: Hardcover
ISBN: 3426281244
Übersetzung: Eva Bonné
Klappentext:
»Ich werde Ihnen erzählen, was passiert ist, denn bei der Gelegenheit kann ich Ihnen meinen Bruder vorstellen. Er heißt Simon. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Wirklich. Doch in ein paar Seiten wird er tot sein. Danach war er nie mehr derselbe.«
Matthew Homes ist ein begnadeter Erzähler, und Patient der Psychiatrischen Klinik in Bristol. Um dort dem trostlosen Alltag zu entfliehen, schreibt er seine Geschichte auf – und die seines Bruders Simon, der im Alter von elf Jahren während des Campingurlaubs in Cornwall starb. Selbst nach zehn Jahren gibt sich Matthew immer noch die Schuld am Unfalltod seines Bruders. Doch eigentlich ist Simon für ihn gar nicht tot – und Matthew auch kein gewöhnlicher 19-Jähriger. Matthew leidet an Schizophrenie …
Rezension:
Wie mir scheint habe ich in diesem Jahr ein Händchen für ungewöhnliche Romane und obwohl schon der Klappentext anklingen lässt, was einen erwartet, war ich doch nicht auf dieses packende Buch vorbereitet, welches mich sowohl inhaltlich, als auch stilistisch überzeugen konnte.
Matthew ist ein im positiven Sinne anstrengender Erzähler. Er spricht den Leser manchmal direkt an (was ich gewöhnlich nicht mag, aber in diesem Fall passend finde) und pendelt zwischen sympathisch, egozentrisch, unwirsch und bemitleidenswert hin und her. Seine Krankheit drückt sich auch darin aus, wie er die Geschichte erzählt. So ist der Roman in verschiedenen Schrifttypen gedruckt, je nachdem, ob Matthew gerade in der Klinik schreibt oder zu Hause auf seiner Schreibmaschine. Das Krankheitsbild wird ebenfalls durch absichtliche Wiederholungen betont und auch die restliche Gestaltung des Romans mit Briefen und Zeichnungen gibt einen Einblick in Matthews Leben. Es ist auf eine merkwürdige Art gleichzeitig chaotisch und dennoch geordnet. Faszinierend, wie Nathan Filer hier Sprache und Layout benutzt, um das Innere seines Protagonisten darzustellen.
Obwohl Matthew also keine Identifikationsfigur im eigentlichen Sinne ist, hält er den Leser vom ersten Satz an in Atem, denn erst am Schluss wird klar, wie genau Simon gestorben ist und wieso sich sein Bruder so schuldig fühlt. Wie ein Puzzle offenbart sich nach und nach die Geschichte, während wir Matthew gleichzeitig in seinem Alltag in der Psychiatrie begleiten. Ich wusste vor „Nachruf auf den Mond“ nicht viel über Schizophrenie, fühle mich zwar auch jetzt nicht als Expertin, aber kann sagen, dass ich auf unterhaltsame Art und Weise sehr viel über die Krankheit erfahren habe, ohne dass sie die eigentliche Geschichte in den Hintergrund gedrängt hätte.
Durch viele Zeitsprünge, die manchmal auch nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, bedarf die Geschichte einer großen Aufmerksamkeit. Aber ich kann nur sagen, lasst Euch darauf ein, denn es lohnt sich wirklich!
Cover haben ja oft nicht sehr viel mit dem eigentlichen Buch gemein, aber in diesem Fall muss ich Droemer ein großes Kompliment machen, denn es finden sich zahlreiche Anleihen an die Handlung des Romans. Simon hat sich immer eine Ameisenfarm gewünscht und der Mond ist eine offensichtliche Anspielung an das Down Syndrom, an dem Simon litt. Letztlich ergibt so auch der Titel einen Sinn.
Note: 2+

 Originaltitel: Station Eleven
Originaltitel: Station Eleven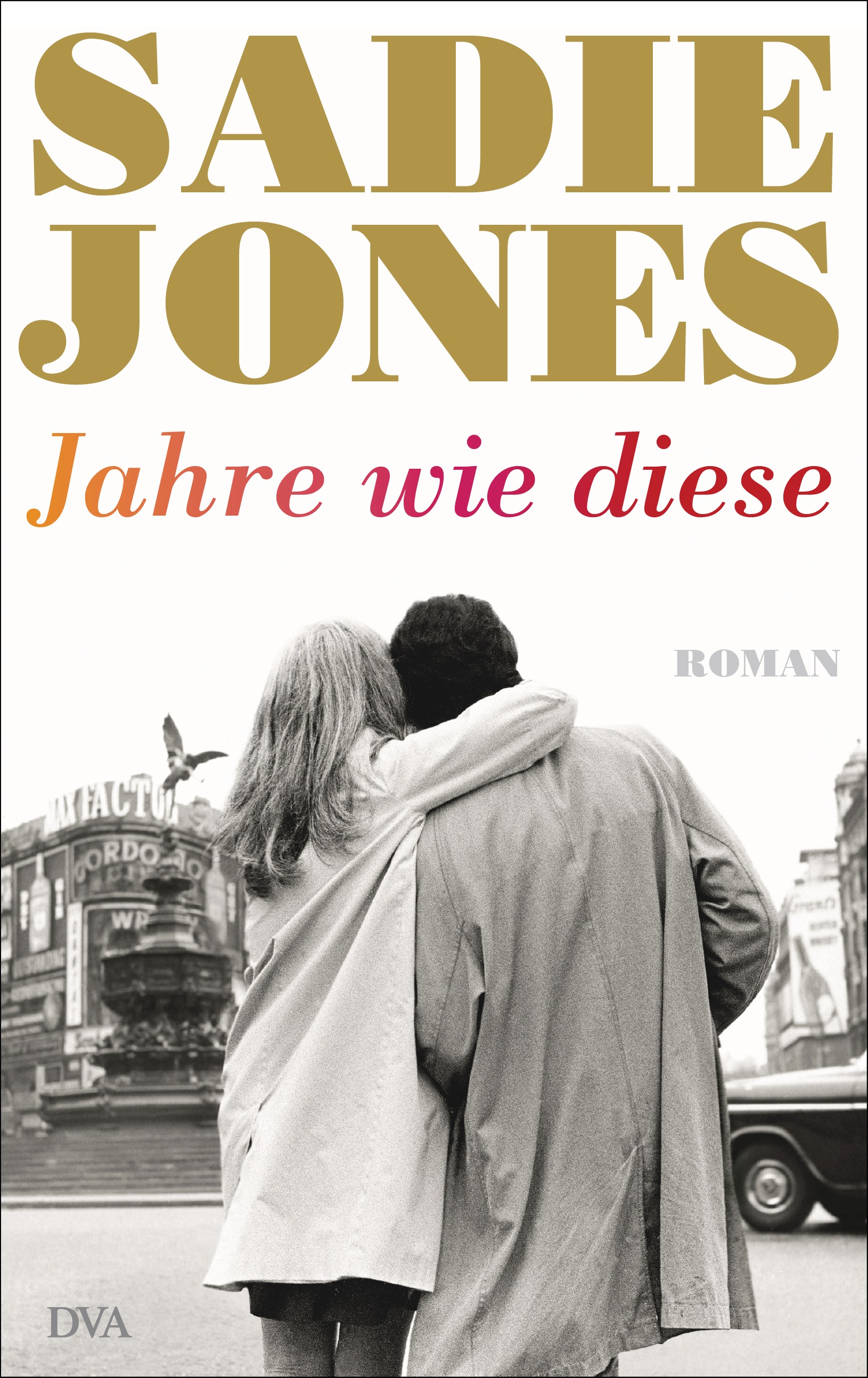 Originaltitel: Fallout
Originaltitel: Fallout Originaltitel: Ishmael’s Oranges
Originaltitel: Ishmael’s Oranges