 Originaltitel: Accès direct à la plage
Originaltitel: Accès direct à la plage
Verlag: Piper
erschienen: 2015
Seiten: 160
Ausgabe: Hardcover
ISBN: 3492056997
Übersetzung: Monika Buchgeister
Klappentext:
Jean-Philippe Blondel avancierte mit seinem Roman „6 Uhr 41“ rasch zum Publikumsliebling. „Direkter Zugang zum Strand“ ist ebenso lebensklug und amüsant. Während man von ersten Lieben, schmerzhaften Trennungen, Überraschungen und unverhofftem Glück liest, spürt man die Sonne im Gesicht am breiten Strand der französischen Atlantikküste. Die französische Atlantikküste, salzige Luft, weiter blauer Himmel: Der kleine Philippe Avril sehnt sich danach, einen Tag im Mickey Mouse Club verbringen zu dürfen, und findet fast einen neuen Freund. Der 18-jährige Jean-Michel träumt sich am Strand weit weg, bis in die noblen Landhäuser auf der anderen Seite des Atlantiks. Und Henri hat vor Kurzem seine Frau verloren, der »Tapetenwechsel« am Meer war die Idee seiner Kinder. Nun sitzt er verlassen im Sand und weiß nichts mit sich anzufangen. Danielle geht als Natacha auf Männerjagd und macht von sich reden. Doch die bösen Zungen wissen nicht, wovon sich Danielle in Wahrheit abzulenken versucht. Zufällige Begegnungen, verpasste Gelegenheiten, unbedachte Geständnisse und kleine Geheimnisse stellen die Weichen für große Veränderungen. Klug und nachdenklich erzählt Jean-Philippe Blondel von sonnigen Tagen am Atlantik und hat dabei das ganze Leben im Sinn.
Rezension:
Das Buch ist in vier Abschnitte aufgeteilt, die jeweils in einer anderen Stadt am Meer in Frankreich spielen. Zwischen den Abschnitten liegen jeweils 10 Jahre, beginnend im Jahr 1972 mit der Geschichte des kleinen Philippe Avril, der den Urlaub wie jedes Jahr mit seinen Eltern am Meer verbringt. Er wäre so gerne auch im Mickey Mouse Club, wo die anderen Kinder scheinbar so viel Spaß haben, doch er muss sich alleine am Strand beschäftigen, während seine Eltern unter dem Sonnenschirm liegen. Zeitgleich schlendert die schöne Danielle am gleichen Strand entlang um unter dem Namen Natascha auf Männerjagd zu gehen, damit sie ihren Schmerz vergisst …
In jedem Zeitfenster gibt es fünf Kurzgeschichten, die jeweils von einer anderen Person handeln, die sich gerade an einem der Urlaubsorte befindet. Es sind immer nur Momentaufnahmen, die einen Blick hinter die Fassade gewähren und oft erschreckend wahr sind. Der Autor schildert seine genauen Beobachtungen und schafft es, dass der Leser sich in die Situationen und das Kaleidoskop der Gefühle hineinversetzen kann, egal ob es um Enttäuschung, Liebe, Träume, Ignoranz oder Gleichgültigkeit geht. Und so ist das Buch mal beschwingt und leicht und dann wieder traurig und fast schmerzlich.
Ein besonderes Kunststück ist dem Autor gelungen, indem er die Personen alle miteinander verknüpft. Auf die ein oder andere Weise sind sie alle jemandem aus den vorangegangenen Kapiteln begegnet, manchmal ohne dass es ihnen bewusst ist. So ist z.B. Danielle/Natascha eine Bekannte von Philippes Mutter und eine weitere Geschichte handelt von einem der Männer, der zu ihren Eroberungen gehört. Nicht immer sind diese Querverbindungen offensichtlich und es war stellenweise eine Herausforderung die einzelnen Puzzlestücke zusammenzusetzen. Am Ende des Buches gibt es vier Schriftstücke die einen Einblick in die Zukunft einzelner Beteiligter gewähren.
Fazit: Ein bunter Strauß aus Lebenseindrücken, der mir ein kurzweiliges Leseerlebnis beschert hat.
Note: 2

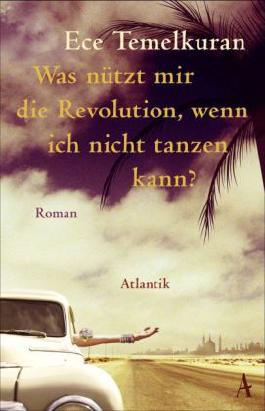 Originaltitel: Düğümlere Üfleyen Kadınlar
Originaltitel: Düğümlere Üfleyen Kadınlar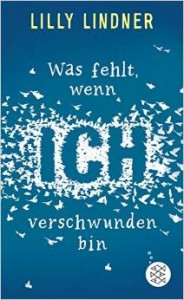 Verlag: Fischer
Verlag: Fischer Originaltitel: Zaïda : Fragments d’une vie
Originaltitel: Zaïda : Fragments d’une vie